
BOGOTA. Zur Küste waren es gerade noch 100 Meter: In Sichtweite des kubanischen Küstenortes Punta de Maisi war das völlig überfüllte Boot der haitianischen Flüchtlinge nicht mehr zu retten. Durch das Leck des alten Kahns strömte zu viel Wasser in den Rumpf, ehe die Retter endlich nahten. Die kubanische Küstenwache kam zu spät. 40 Haitianer ertranken in den Fluten; immerhin doppelt so viele kamen zumindest mit dem Leben davon.
Der Untergang des Flüchtlingsbootes unmittelbar vor Weihnachten lenkte noch einmal für kurze Zeit die Aufmerksamkeit der Medien auf das tägliche Drama, das Haiti seit dem Erdbeben vor zwei Jahren erlebt. Am 12. Januar 2010 erschütterte ein Erdstoß die Karibikinsel: Mehr als 220.000 Menschen fanden den Tod. Für Wochen beherrschte die bettelarme Insel die weltweiten Schlagzeilen.
Mittlerweile ist es wieder ruhig geworden um Haiti - zu ruhig. Fast alle internationalen Journalisten haben das Land verlassen. Neue Katastrophen wie die in Pakistan oder in Japan verdrängten das Elend der Haitianer aus den Nachrichten. Pünktlich zum zweiten Jahrestag des Erdbebens schicken die zahlreichen Hilfsorganisationen ihre Zwischenbilanzen. Sie sind geprägt von Erfolgsmeldungen und vorsichtigem Optimismus. Doch die Realität sieht häufig anders aus: Immer noch hausen Hunderttausende Menschen in improvisierten Zeltlagern. Viele haben trotz der internationalen Hilfe die Hoffnung verloren, dass sich die Situation im Land bessert.
Und so lassen sich die Verzweifelten auf halsbrecherische Aktionen wie die Flucht in seeuntüchtigen Booten ein. Sie kratzen ihr letztes Geld zusammen, um von skrupellosen Geschäftemachern ein „Ticket“ für die Überfahrt zu kaufen. Die Ziele sind Jamaika, Kuba oder Miami. Dort - so hoffen die „Boatpeople“ - gibt es Arbeit und eine Perspektive. Doch wenn sie die lebensgefährliche Überfahrt überhaupt überstehen, wartet die nächste Enttäuschung: Willkommen sind die Flüchtlinge weder im sozialistischen Kuba noch im kapitalistischen Miami. Erst mal aufgegriffen, ist das Szenario überall das Gleiche wie im kubanischen Punta de Maisi: Erst gibt es Lebensmittel und Medikamente und dann die Rückfahrt in die Armut nach Haiti.
Den vermeintlichen Ausweg aus der Armut über das Meer gab es bereits vor dem Erdbeben. Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes starben im Jahr 2007 mindestens 82 Menschen im Karibischen Meer. Überlebende berichteten damals, dass einige ihrer Mitreisenden von Haien gefressen wurden. 2009 kenterte vor der Küste der Turks- und Caicos-Inseln im Norden Haitis ein Flüchtlingsboot. Mindestens 15 Menschen sollen dabei ertrunken sein. Damals gab es allerdings noch nicht die großen Anstrengungen der Hilfsorganisationen, die seit dem Erdbeben die Insel bevölkern. Trotz ihrer Arbeit ist die Armut geblieben. Und doch gibt es Anzeichen von Hoffnung. Neue Schulen und Universitäten sind eröffnet worden, sogar ein Luxushotel für Geschäftsleute ist in Planung. Laut UNICEF können heute mehr als 750.000 Kinder in Haiti wieder zur Schule gehen.
Staatspräsident Michel Martelly kündigte jüngst an, in Bildung, Sicherheit und Justiz investieren zu wollen. Doch Vielen geht es nicht schnell genug voran: Der Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Misereor, Josef Sayer, fordert von der internationalen Gemeinschaft mehr Druck auf Haitis Regierung, um „so schnell wie möglich die erforderlichen Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Wiederaufbau“ zu schaffen. Viele Haitianer scheinen jedoch nicht daran zu glauben, dass sich in naher Zukunft etwas ändern könnte. Sie entscheiden sich für die gefühlt letzte Option: die waghalsige Flucht über das Meer.


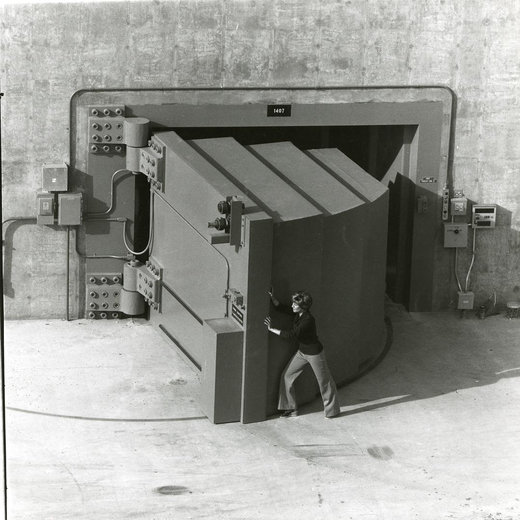
Kommentare von Lesern
für unseren Newsletter an