Innsbruck - Steter Tropfen höhlt den Stein, heißt es. Und wenn es oft auch ein ganzes Leben dauert, irgendwann hält einem der Körper den Spiegel vor - zeigt, wie die Kindheit verlaufen ist. Es geht um Traumata: körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, aber auch andauernde emotionale Vernachlässigung. Ein Kindheitstrauma hinterlässt bleibende Spuren im Gehirn von Kindern und Jugendlichen, welche - erstens - über Generationen weitergegeben werden und sich - zweitens - in einer um bis zu zwanzig Jahre verringerten Lebenserwartung niederschlagen können.
Kommentar:
Bei der 17. Fachtagung der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie, veranstaltet von der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie, haben Experten in Innsbruck unlängst das Thema Trauma aus einem medizinischen Blickwinkel erörtert. „Ein Trauma ist vorhanden, wenn eine Belastung nicht verarbeitet werden kann“, sagt der deutsche Psychiater Ulrich Tiber Egle. Wenn Bezugspersonen nicht in dem Maß für Kinder da sind, wie es ihr Alter und die Entwicklungsphase fordern - sie z. B. ignorieren oder nicht trösten - , kann das dazu führen, dass Kinder ihr ganzes Leben daran zu knabbern haben. „Es kommt zu ungünstigen Veränderungen im Gehirn, die das Stressempfinden lebenslang beeinflussen.“
Zwei Botenstoffe spielen eine wesentliche Rolle: Stimmt die Bindung nicht, schraubt das Gehirn die Herstellung des Kuschelhormons Oxytocin zurück. Genug Oxytocin schafft im Gehirn aber Andockstellen für das Stresshormon Cortisol. Wenn es zu wenig Oxytocin gibt, fehlen also diese Andockstellen, an denen Cortisol ankern kann. Bei Stress überschwemmt Cortisol quasi das Gehirn und wirkt als Zellgift.
Kommentar: Polyvagal-Theorie: Die drei neuralen Kreisläufe als Regulatoren für unser reaktives Verhalten
Zusätzlich tragisch ist für Egle, dass Oxytocin-Mangel vererbt wird. Ein Teufelskreis entsteht, aus dem man schwer ausbrechen kann. Denn schon traumatischer Stress der werdenden Mutter - häusliche Gewalt, ein Trauerfall oder Unfall - kann sich negativ auf das Baby im Bauch auswirken.
Großangelegte Langzeitstudien in Großbritannien und auf einer kleinen Nebeninsel von Hawaii hätten gezeigt, dass Erwachsene, die über traumatische Erlebnisse in der Kindheit berichteten, ein kürzeres Leben haben. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 79 Jahren wurden die belasteten Studienteilnehmer im Schnitt nur 60 Jahre alt. Sie erlitten Herzinfarkte und Schlaganfälle. Asthma, Diabetes, Hepatitis, COPD, chronische Schmerzen und Fibromyalgie sind ebenso häufige Krankheitsformen nach Traumatisierungen - Folgen von Risikoverhalten. „Die einen lassen sich frühzeitig professionell psychologisch behandeln, die anderen behandeln sich selbst. Das Spannungsgefühl - Druck, Panik, Herzrasen - versuchen sie durch Risikoverhalten zu lindern“, bringt der Psychiater das Problem auf den Punkt.
Bei Buben sehe das heutzutage häufig so aus: Sie werden aggressiv, prügeln sich und trinken übermäßig viel. Mädchen würden hingegen eher versuchen, ihr angeschlagenes Selbstbewusstsein mit häufig wechselnden Partnern aufzurichten. Doch auch bei ihnen nehme der Alkoholkonsum zu. Frustfressen sei bei beiden Geschlechtern ein häufiger Bewältigungsmechanismus.
Die Zahlen sind besorgniserregend: Sechs Prozent der Mädchen und vier Prozent der Buben erleben in Deutschland sexuellen Missbrauch. Neun Prozent werden in der Familie regelmäßig Opfer körperlicher Gewalt. Unter emotionaler Vernachlässigung haben Schätzungen zufolge bis zu einem Viertel der Kinder und Jugendlichen zu leiden. In Österreich gibt es laut Tagungspräsidentin Astrid Lampe von der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie keine flächendeckenden Studien.
Kommentar:
- Sexueller Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie steigen an
- Sexueller Mißbrauch und seine Folgen
Die internationalen Forschungsergebnisse sollen nun dafür genutzt werden, Betroffene gezielter medizinisch und psychosomatisch betreuen zu können. „Es gibt auch viele Ansätze zur Prävention“, sind sich Egle und Lampe einig. So müssten alleinerziehende Elternteile und psychisch kranke Eltern verstärkt unterstützt werden. Auch spezielles Bindungstraining, bei dem Eltern z. B. beigebracht wird, wie sie ihr Kind trösten können, sollte verstärkt gefördert werden.
Neben einer guten Bindung gibt es noch weitere ausgleichende Schutzfaktoren bei traumatischen Erlebnissen: Hohe Intelligenz und eine angeborene Extrovertiertheit helfen, schlimme Erlebnisse wegzustecken. Und auch Mädchen sind genetisch bedingt - außer in der Pubertät im Alter von zwölf bis 15 - den Buben gegenüber klar im Vorteil.



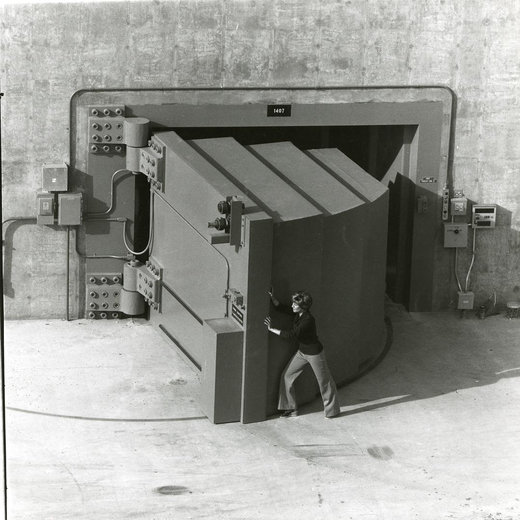
Kommentare von Lesern
für unseren Newsletter an