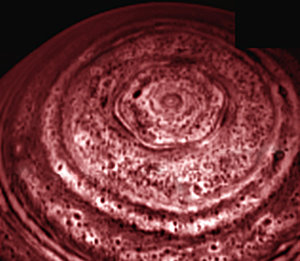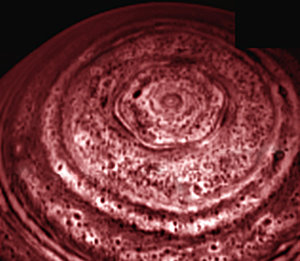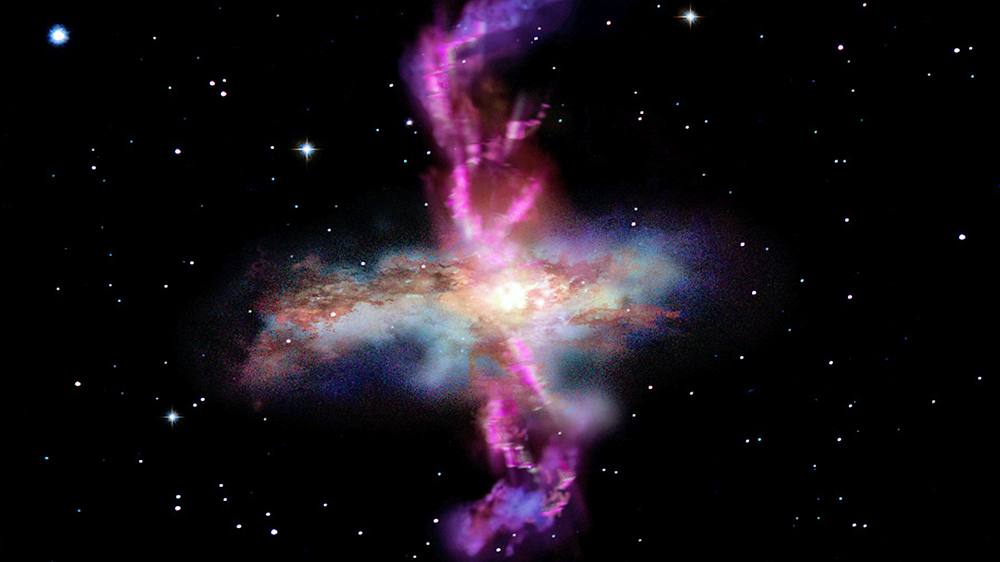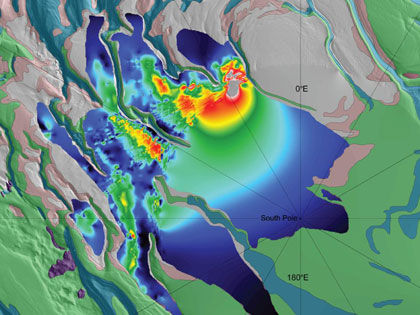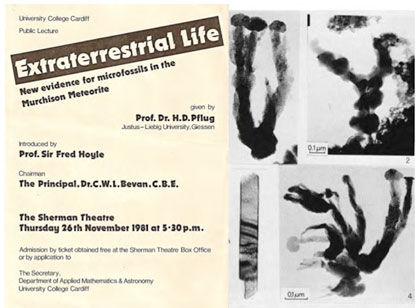© Reuters/Russell CheyneA bumble bee lands on a plant in Pitlochry in Scotland May 29, 2010.
Handy-Strahlung könnte für das mysteriöse, weltweite Bienensterben verantwortlich sein, das Wissenschaftler vor ein Rätsel gestellt hatte.
Dr. Daniel Favre, ein ehemaliger Biologe des Swiss Federal Institute für Technologie in Lausanne, Schweiz, platzierte vorsichtig ein Handy unter einen Bienenstock und beobachtete die Reaktionen der Arbeiterbienen.
Laut
einem Bericht in The Daily Mail, waren die Bienen in der Lage festzustellen, wann die Handys Anrufe tätigten oder empfingen. Sie reagierten mit einem hohen Quietschen, das normalerweise das Signal zum Aussschwärmen ist.
"Diese Studie zeigt, dass die Anwesenheit eines aktiven Handys die Bienen stört -- und einen dramatischen Effekt hat", sagte Favre der
Daily Mail.
Favre glaubt, dass dies ein Beweis dafür ist, worauf andere Wissenschaftler hingewiesen haben: Signale von Handys tragen zur Abnahme der Honigbienen bei. Favre denkt, dass genauere Forschung dabei helfen könnte, die Verbindung zwischen Handy-Signalen und dem "Bienenvolk-Kollaps" zu bestätigen -- das plötzliche Verschwinden ganzer Kolonien im Winter -- was die Bienenpopulation laut einiger Schätzungen halbiert hat.