Wir nehmen unsere Herausforderung als Staatsbürger als einen riesigen Rubikschen Würfel bzw. Zauberwürfel wahr. Hinter jedem Problem liegt ein weiteres Problem, das zuerst gelöst werden muss; und dahinter liegt noch ein weiteres, und dann noch ein weiteres - ad infinitum. Um Verbrechen zu beheben, müssen wir die Familie heilen; doch bevor wir das tun können, müssen wir den Sozialstaat reparieren. Und das bedeutet, dass wir unser Budget in Ordnung bringen müssen. Was wiederum heißt, dass wir unseren Gemeinsinn als Staatsbürger heilen müssen, was jedoch ohne die Korrektur moralischer Standards nicht möglich ist. Und das bedeutet, die Zustände in Schulen und Kirchen in Ordnung zu bringen; und damit auch unsere Innenstädte. Doch das ist unmöglich - es sei denn, wir beheben das Verbrechen. Es gibt keinen Dreh- und Angelpunkt, an dem sich ein Hebel politischer Richtlinien ansetzen lassen könnte. Menschen jeden Lebensalters ahnen, dass etwas Riesiges über Amerika hinwegfegen muss, bevor sich die Düsternis heben kann - aber das ist ein Gewahrsein, das wir unterdrücken. Als Nation befinden wir uns in einem Zustand tiefer Verleugnung.Die Bücher "Generations: The History of America's Future" (1992) und "The Fourth Turning: Was uns die Zyklen der Geschichte über die Zukunft unserer Gesellschaft lehren" (2022) von den Historikern William Strauss und Neil Howe identifizieren und kategorisieren dokumentierte historische Zyklen über viele Kulturen und Epochen hinweg. In beiden Büchern werden die Zeitlinien geschichtlicher Ereignisse analysiert und in Beziehung zu spezifischen Lebenszyklen gesetzt, die als Generations-"Typen" gekennzeichnet sind. Strauss und Howe besprechen das Konzept der Zeit im Kontext sowohl zirkulärer als auch linearer Perspektiven. In diesem Sinne beschreiben sie das "saeculum" als ein "lange andauerndes menschliches Leben", das ungefähr 80 bis 90 Jahre beträgt und vier Abschnitte umfasst, die jeweils ca. 20 bis 22 Jahre anhalten.
- Straus und Howe (1997): "The Fourth Turning", ERSTE AUSGABE, S. 2
So wie es vier Jahreszeiten gibt, die aus Frühling, Sommer, Herbst und Winter bestehen, gibt es auch vier Phasen eines menschlichen Lebens, die als Kindheit, Jugend, Mittlere Jahre und Alter erlebt werden.


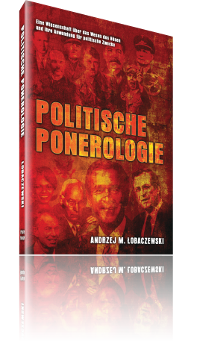



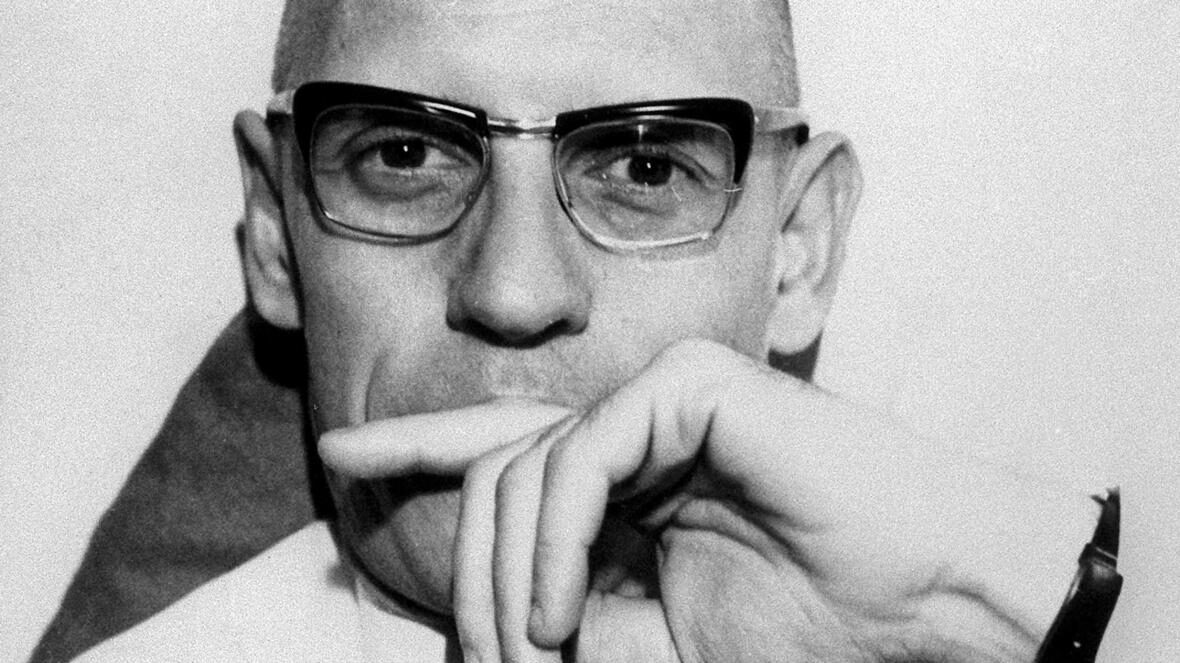

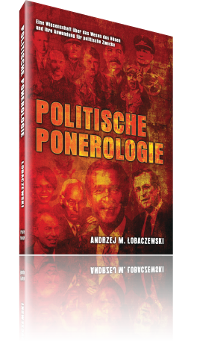




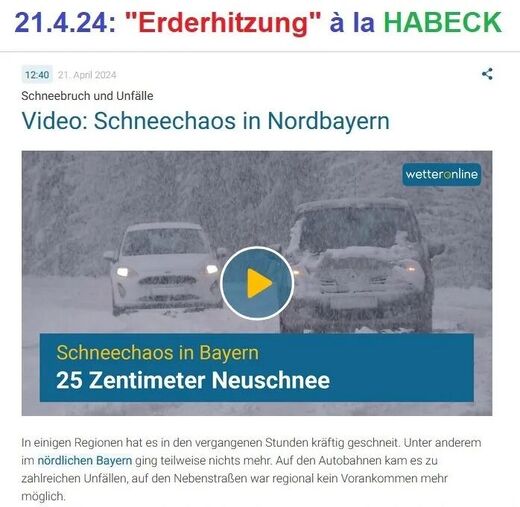
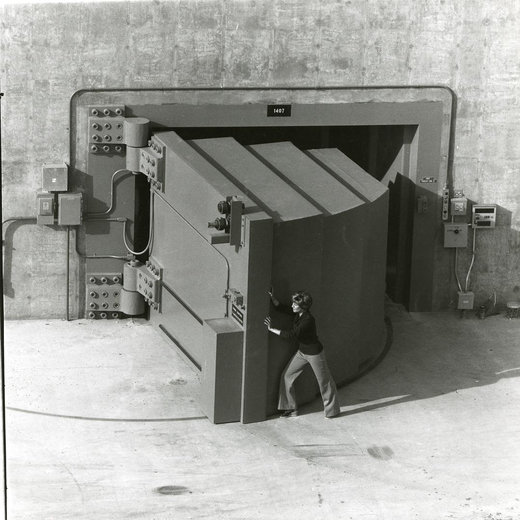
Kommentar: ~ Zitate aus den Werken von Carlos Castaneda