Das kurze Video weiter unten wird den Weg dafür bereiten, worüber ich in diesem Artikel sprechen werde. Ich bitte Sie alle, die diesen kurzen Bericht lesen, dringend darum, auch den Artikel
The New COINTELPRO: Cyberwarfare 'hacktivists' and the Subversion of Anonymous zu lesen (und klicken Sie die Links und überprüfen Sie die Beweise!). Es sieht so aus, als würden im Moment Agenten jeglicher Form und Ausprägung überall aktiviert werden; und nicht nur SOTT wird anvisiert!

© dpa
Jemand kommentierte auf den oben verlinkten Artikel, dass er es als Zeitverschwendung für SOTT einschätze, über diese Art von Dingen zu berichten und sie zu entblößen -- dass es eine 'Ablenkung' sei. Sorry, aber wir sehen das nicht so. Aus unserer Perspektive ist die Entblößung der Wege und Methoden von 1) bewussten, bezahlten Regierungsagenten, 2) unbewussten 'nützlichen Idioten', denen verdeckt zu Positionen von Vertrauen/Autorität in diversen Bewegungen verholfen wird, extrem hilfreich für jeden, der in sozialem Aktivismus involviert ist. Das Mem "Ignorier es einfach, es wird schon wieder weggehen" oder "Wenn du nichts Nettes sagen kannst, sag am besten gar nichts" und "Die Zeit und der Aufwand lohnen sich nicht" etc. wird von den pathologischen Menschen an der Macht verbreitet.
Unsere Welt wird heutzutage von
Psychopathologie regiert; darauf läuft es hinaus und das ist der Grund, warum alles so verkorkst ist wie es ist. Doch Psychopathologie kann nur dann regieren, wenn die Menschen sich ihrer nicht bewusst sind und nicht wissen, wie genau sie operiert. Das ist der Grund dafür, dass wir diese |Dramen| veröffentlichen. Abgesehen davon ist das viel besser als Fernsehen!
So, und nun zum Video!
Wie ich in obigem Video sage, habe ich durch meine Arbeit über Psychopathologie in der modernen westlichen Kultur mehr Angriffe erlebt als durch jedes andere Thema, über das ich jemals geforscht und geschrieben habe. Seit wir
Fellowship of the Cosmic Mind gegründet haben, eine handelsgerichtlich eingetragene Religion -- die darauf basiert,
nicht an irgendetwas (oder irgendjemanden) zu glauben, sondern unsere Glaubensvorstellungen auf die objektive Realität abzustimmen --, und ihr wissenschaftliches, stressreduzierendes, heilendes und verjüngendes Atemprogramm, sind die Dinge in dieser Hinsicht vollkommen VERRÜCKT geworden. Man könnte glatt denken, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, da diese pathologischen Kriechtiere plötzlich alle auf einmal aus dem Unterholz gekrabbelt kommen! Die große Frage lautet: Werden wir es überleben? Ich vermute, das wird von unseren Lesern abhängen und wieviel Unterstützung wir bekommen und wie weit sie die Informationen verbreiten werden, die ich Ihnen heute mitteilen werde.
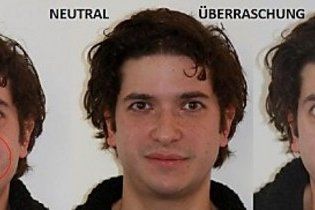
Kommentar:
Dieser Artikel ist Teil einer Forschungs-Serie von Sott.net: