Während sich die Übergewichts-Epidemie weltweit Bahn bricht, rätseln Wissenschaftler über ein Phänomen, das die bisherigen Erkenntnisse auf den Kopf zu stellen scheint. Zwar bestehen nach wie vor keine Zweifel daran, dass starkes Übergewicht etlichen Krankheiten den Weg bereitet. So begünstigt es nachweislich die Entstehung von hohem Blutdruck, Störungen des Fettstoffwechsels und Diabetes - Risikofaktoren, die, insbesondere wenn sie gemeinsam auftreten, die Gefäßalterung gleichsam im Zeitraffer ablaufen lassen. Die beschleunigte Arterienverkalkung ist auch ein Grund, weshalb Personen mit großer Leibesfülle vermehrt an Herzinfarkten und anderen arteriosklerotisch bedingten Herzkreislaufleiden erkranken. Das Paradoxe ist gleichwohl: Sind sie erst erkrankt, kommt ihnen eine gute Fettpolsterung offenbar zugute. Jedenfalls legen die Ergebnisse etlicher epidemiologischer Erhebungen den Schluss nahe, dass dicke Herzkranke seltener tödlichen Komplikationen erliegen als schlanke. Die Wissenschaftler sprechen daher auch von einem Adipositas-Paradoxon.
Ob dieses tatsächlich existiert, lässt sich allerdings noch nicht mit Sicherheit sagen. Denn die bisherigen Untersuchungen waren entweder zu klein oder aus methodischen Gründen nicht in der Lage, eine Laune des Zufalls oder andere Störeinflüsse auszuschließen.
Buchstäblich neue Nahrung erhält das Kuriosum nun von zwei neuen Erhebungen, deren Ergebnisse soeben in den „Mayo Clinic Proceedings“ (doi: 10.1016/j.mayocp.2014.04.020) veröffentlicht wurden. Auf der Suche nach einschlägigen Belegen haben Wissenschaftler um Abishek Sharma von der State University in Brooklyn/New York die medizinische Fachliteratur nach Studien durchkämmt, in denen der Einfluss des Körpergewichts auf das gesundheitliche Schicksal von Patienten mit arteriosklerotischen Herzleiden verfolgt wurde. Dabei stießen sie auf 36 Studien, die ihren Anforderungen genügten und daher in ihre Meta-Analyse Eingang fanden. Die darin einbezogenen Probanden, mehr als 200000 Männer und Frauen mittleren Alters, hatten sich alle einer Gefäßbehandlung am Herzen unterzogen. Im Verlauf von eineinhalb bis zwei Jahren waren dann knapp dreitausend der Patienten verstorben, die meisten an einem Infarkt oder einem anderen Herzkreislaufleiden. Patienten, die sich am unteren Ende der Gewichtsskala befanden, ereilte ein solches Schicksal aber weitaus häufiger als Normalgewichtige. Noch seltener betroffen waren hiervon die Dicken, und zwar unabhängig davon, wie viele überflüssige Pfunde sie auf die Waage brachten.
Kommentar: Ein Hinweis darauf, dass gesättigte Fette schützend wirken?
Die Wahrheit über gesättigte Fette
Wie viel Fett, wie viel Magermasse?
Die Erkenntnisse der amerikanischen Forscher hinterlassen allerdings mehr Fragen als Antworten. Offen bleibt insbesondere, in welchem Gesundheitszustand sich die einzelnen Teilnehmergruppen befanden. Nicht ausschließen lässt sich nämlich, dass die Dünnen gebrechlicher waren als die Fülligen und krankheitsbedingt weniger verzehrten. Mäßige Aussagekraft besitzt darüber hinaus der von den Forschern verwendete Body-Mass-Index, der Quotient aus dem Körpergewicht und der Körpergröße zum Quadrat. Dieser kurz BMI genannte Parameter, der gemeinhin zur Unterscheidung zwischen Dünn und Dick genutzt wird, erlaubt nämlich keine Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Körpers, also wie viel Fett und wie viel Magermasse dieser enthält. Lediglich übermäßige Speckpolster können der Gesundheit aber zusetzen, nicht hingegen kräftige Muskeln und Knochen.
Diese Limitationen haben die Autoren der zweiten Studie in ihren Berechnungen berücksichtigt - und kommen entsprechend zu einem etwas differenzierteren Ergebnis. Bei ihren Analysen stützten sich der Kardiologe Alban de Schutter von der University of Queensland School of Medicine und seine Kollegen auf die Krankenakten von knapp 48000 Männern und Frauen, die wegen eines Herzleidens an ihrer Klinik versorgt worden waren (doi: 10.1016/j.mayocp.2014.04.020). Bei der Gelegenheit hatten die Ärzte nicht nur den Body-Mass-Index bestimmt, sondern auch den Fettgehalt und die Magermasse. Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ereigneten sich dann mehr als 3700 Todesfälle. Bei alleiniger Betrachtung des Body-Mass-Indexes sah es auch in dieser Studie so aus, als ob die Dicken durchweg am besten davonkämen. Denn das Risiko, im Verlauf von drei Jahren zu versterben, war bei Personen mit hohem BMI am geringsten und bei jenen mit niedrigem BMI mit Abstand am größten. Ein anderes Bild ergab sich indes, wenn die Wissenschaftler die Körperbeschaffenheit in ihre Berechnungen mit einbezogen. Dabei zeigte sich, dass die Sterblichkeit weitgehend von der Magermasse abhing: Je größer diese war, desto eher blieb der Herzkranke am Leben. Dies galt sowohl für die Dicken als auch für die Dünnen und war zudem unabhängig von der Größe der Fettpolster. Im Klartext heißt das: Ein erhöhtes Körpergewicht bringt vornehmlich dann einen Überlebensvorteil, wenn die Muskeln gut ausgebildet sind. Dieser auch in anderen Studien gefundene Zusammenhang sei „nicht überraschend“, schreiben De Schutte und die anderen Studienautoren. Denn die Magermasse hänge von der Muskelmenge ab und sei damit ein Maß für die körperliche Fitness.
Speckreserven können nützen
Ebenfalls kaum verwunderlich ist, dass die untergewichtigen Patienten in beiden Studien besonders schlecht abschnitten. Denn wie viele Beobachtungen nahelegen, kommt es alten und kranken Personen zugute, wenn sie über ausreichende Speckreserven verfügen. „Bei Krebskranken und Patienten mit Herzschwäche deutet ein geringes Körpergewicht auf eine erhöhte Sterblichkeit hin“, sagt Georg Ertl von der Medizinischen Klinik und Poliklinik I der Universität Würzburg. „Besonders ungünstig ist für die Betroffenen ein Gewichtsverlust.“ Denn dieser sei häufig die Folge einer krankhaften Auszehrung. Fettvorräte würden kranken Menschen daher möglicherweise eine gewisse Resistenz verleihen. „Patienten mit größeren Speckpolstern können den krankheitsbedingten Stress vermutlich besser verkraften als schlanke“, erklärt der Kardiologe. In Gegenwart einer schweren Erkrankung kehrten sich auch die Vorzeichen anderer Risikofaktoren vielfach um. So seien niedrige Blutdruckwerte bei Patienten mit Herzschwäche ein schlechtes Zeichen, erhöhte Cholesterinwerte hingegen eher von Vorteil.
Kommentar: In der Tat: Cholesterin-Theorie über Herzkrankheiten ist Unsinn: Gesättigte tierische Fette sind äußerst wichtig und gesund
Wie Ertl klarstellt, sind epidemiologische Studien wie die hier beschriebenen kaum geeignet, den Zusammenhang zwischen dem Gewicht und der Sterblichkeit aufzuklären. „Das individuelle Risiko erschließt sich nicht aus solchen Erhebungen, wahrscheinlich auch nicht mit den Mitteln der personalisierten Medizin.“ Es sei vielmehr durch die Gene, die Prägung während der Kindheit und der Jugend und das Verhalten im weiteren Leben bestimmt. „Dass massives Übergewicht die Lebenserwartung einschränkt - abgesehen von allen anderen gesundheitlichen Problemen - darf die Epidemiologie unserer Bevölkerung nicht ausreden.“
Fett ist andererseits nicht gleich Fett. Ungünstige Auswirkungen auf die Gesundheit besitzt laut den bisherigen Erkenntnissen lediglich Bauchspeck. Denn während sich das Unterhautfettgewebe metabolisch ruhig verhält, greift das Eingeweidefett aktiv in den Stoffwechsel ein - und zwar, indem es entzündungsfördernde Signalmoleküle ausschüttet. Die beständige Überflutung mit Entzündungsstoffen gilt als auch ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Wegbereiter der adipositasbedingten Gesundheitsstörungen. Das Adipositas-Paradoxon mag somit manche Menschen beruhigen, als ein Freibrief für hemmungslose kulinarische Freuden taugt es gleichwohl kaum.



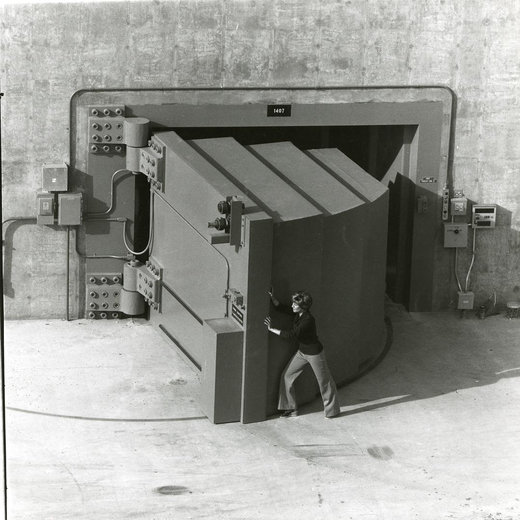
Kommentare von Lesern
für unseren Newsletter an