
Einschlag mit Tempo 60 000
Der 34 Kilometer breite Einschlagtrichter ist für Laien unsichtbar und auch aus der Satellitenperspektive nicht zu erkennen. Er verbirgt sich unter einer bis zu vierhundert Meter dicken Schicht aus rotem Wüstensand und Sandstein. Aus dem Schockmuster des Gesteins und der Kratergröße lässt sich aber ein einigermaßen präziser Steckbrief des Himmelsgeschosses erstellen. Nach Kenkmanns Berechnungen hatte der Meteorit einen Durchmesser von 2,6 Kilometern und schlug mit 60 000 Stundenkilometern auf der Erde ein. Wann es zum Aufprall kam, ist noch relativ unklar. Kenkmanns Schätzungen schwanken zwischen 70 und 400 Millionen Jahren.
Bislang wurden auf der Erde insgesamt 188 Meteoritenkrater entdeckt. Der jüngste Fund in der Nefud-Wüste zählt mit seinem 34-Kilometer-Durchmesser zu den Top 25. Zum Vergleich: Der größte jemals vermessene Krater erstreckt sich über 250 Kilometer in Südafrika. Der kleinste bringt es gerade mal auf eine Grube von 15 Metern und befindet sich am Ufer des Titicacasees. Thomas Kenkmann war einer der Ersten, die den Minikrater in Südamerika unter die Lupe genommen hatten, wenige Tage nach dem Einschlag am 15. September 2007. Ein Highlight seines bisherigen Forscherlebens. Denn der Meteorit dürfte nicht größer als einen Meter gewesen sein. Normalerweise zerbröseln solche kosmischen Bonsai-Bomben in der Atmosphäre. "Er hatte den perfekten Flugwinkel, vergleichbar mit dem eines Spaceshuttles, das auf die Erde zurückkehrt", erklärt Kenkmann.
Freiburger Krater-Forschung weltweit führend
Nun will sich der Freiburger Geologe möglichst bald auch ein Bild von dem Krater in Saudi Arabien machen. Für seine Forschung vor Ort benötigt er allerdings grünes Licht von Saudi Aramco. Kenkmann ist guter Dinge. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Erdölkonzern zusammenarbeitet.
Bei der Erforschung von Meteoritenkratern gilt der Standort Freiburg weltweit als führend. Verantwortlich dafür ist das Bündnis zwischen dem Institut für Geologie und dem Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik. Im September hatten sich mehr als hundert Wissenschaftler aus der ganzen Welt auf der Internationalen Konferenz zur Impakterforschung an der Albert-Ludwigs-Universität ausgetauscht.

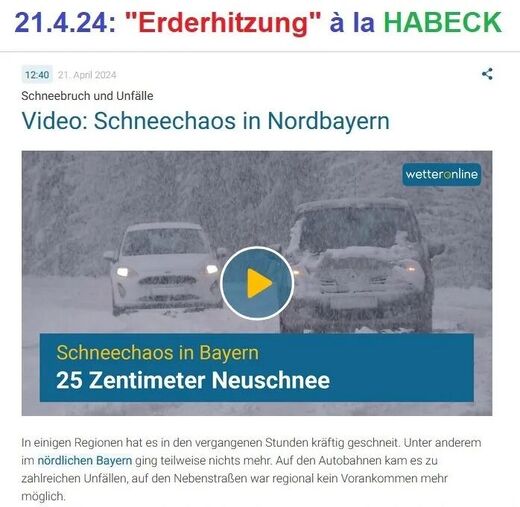
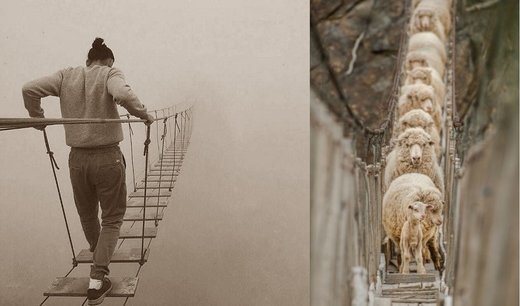
Kommentar: