Mehr als fünfzig Doktoranden gab es insgesamt an der Klinik - allesamt fertig examinierte Tierärzte -, nur einige wenige bekamen nicht nur zehn Euro im Monat, sondern 400 bis 450. So steht es in dem anonymen Brief, mit dem einer der Doktoranden Ende Januar Medien, Parteien und Gewerkschaften alarmierte. Darin warnt der Tierarzt auch, dass die Sicht der Klinik sei, sie leisteten keine „echte“ Arbeit, sondern die Routinetätigkeiten dienten ihrer Aus- und Weiterbildung. Der Zeitpunkt für den Brief war nicht zufällig: Durch das neu in Kraft getretene Mindestlohngesetz konnte der Whistleblower darauf hoffen, dass sein Anliegen Gehör finden würde.
Und so war es auch. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete mehrfach auf ihrer Münchner Lokalseite. Die Grünen-Fraktion Bayern sorgte dafür, dass die bayerische Staatsregierung gebeten wurde, sich zu positionieren. Auch das Hauptzollamt München, zuständig bei Verstößen gegen das Mindestlohngesetz, begann - das ergaben Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ - zu ermitteln. Und die Hochschulleitung der LMU forderte den Dekan der Veterinärmedizinischen Fakultät, Joachim Braun, umgehend zu einer Stellungnahme auf. „Ich habe schnell festgestellt, dass die Fakten in dem anonymen Brief stimmen“, sagt Braun, der angibt, zuvor von den Zuständen in der Klinik nichts gewusst zu haben. „In der Klinik haben Tierärzte unbezahlt gearbeitet. Ihre klinische Arbeit kann nicht als Ausbildung gewertet werden. Sie müssen dafür bezahlt werden.“
Und so wird es nun auch kommen. Bernd Huber, Präsident der LMU, hat sich wiederholt mit Doktoranden und Klinikleitung getroffen und Anfang Mai eine Lösung vorgelegt. 15 Euro sollen die Doktoranden künftig pro Stunde bekommen und, wenn sie Vollzeit arbeiten, diese Zeit auch anerkannt bekommen. Sie werden zudem rückwirkend ab dem 1. Januar 2015 diesen Lohn erhalten, da ja mehrere Wochen lang gegen das Mindestlohngesetz verstoßen worden war. „Wir werden der Fakultät kurzfristig helfen, weil in dieser besonderen Situation höhere Kosten entstehen“, erklärt Huber. Auf lange Sicht müsse die Klinik ihre Arbeitskräfte aber selbst finanzieren. „Wir haben uns darauf beschränkt, eine rechtskonforme Situation herzustellen“, sagt Huber. Für ihn ist der Fall damit erledigt.
Für die deutschen Veterinärmediziner ist er es nicht, unter anderem, weil nun auch Doktoranden an den anderen vier tiermedizinischen Fakultäten nachziehen: In der Juniausgabe des Leipziger Stadtmagazins „Kreuzer“ erschien ein Artikel, der ähnliche Arbeitsbedingungen an der dortigen Universitätskleintierklinik zum Thema hat: 19 Stunden arbeiten die Doktoranden dort laut Vertrag, doch sie beklagen, es seien in Wirklichkeit doppelt so viele. Die Universität Leipzig gab umgehend eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß: „Die zuletzt auch öffentlich geäußerte Kritik im Hinblick auf eine angemessene Bezahlung geleisteter Arbeit sehen Universitäts- und Fakultätsleitung in wesentlichen Punkten als berechtigt an und wollen die bestehenden Probleme gemeinsam lösen.“ 90.000 Euro soll die Veterinärmedizinische Fakultät zusätzlich zu ihrem Budget des Jahres 2015 bekommen, um die Betroffenen komplett vergüten zu können.
Die Vorfälle berühren eines der heißesten Eisen des Berufsstandes: die soziale Selektion bei Hochschulkarrieren in der klinischen Veterinärmedizin. Der Brief der Münchner Doktoranden gipfelt in einem entscheidenden Satz: „Im Grunde muss die Lizenz, eine Doktorarbeit in der Klinik anfertigen zu dürfen, durch unbezahlte Arbeit in der Klinik erkauft werden.“
Wer an der Kleintierklinik der LMU in die Hochschullaufbahn einsteigen wollte, musste sich mehr als Vollzeit zur Verfügung stellen, er musste zusätzlich ohne Vergütung seine Nächte und Wochenenden opfern. Nach der Arbeit kellnern oder im Hostessenkostüm auf Messen lächeln - das war unmöglich. Dort promovieren und sich weiterbilden konnten also nur diejenigen, die für mehrere Jahre nach ihrem Examen überhaupt nicht auf Einkünfte angewiesen waren.
An den veterinärmedizinischen Fakultäten spricht man vorsichtig über diese Zusammenhänge. Aber man kennt sie. „Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, beim Promovierendenball jedes Jahr mit einem Glas Wein von Tisch zu Tisch zu gehen, um die Eltern kennenzulernen“, sagt der Münchner Dekan Joachim Braun. „Einen Lokführer habe ich da noch nicht getroffen.“ Stattdessen: „Gutsituierte Akademiker“, sagt Braun.

Der finanzielle Hintergrund entschied darüber, ob hoffnungsvolle Absolventen zum Zuge kamen oder nicht. Dabei ging es nicht nur um den Doktortitel. Wer mehrere Jahre kaum bezahlt an einer universitären Tierklinik arbeitet, als Promovend, oder, oftmals längst mit Doktortitel, als sogenannter „Intern“, sammelt wichtige Weiterbildungszeit, um eine Qualifikation zu erwerben, die für die Hochschullaufbahn heute unabdingbar ist: Er kann „Diplomate“ werden, sich zu einem europaweit anerkannten Spezialisten weiterbilden - etwa für Kleintierchirurgie, Dermatologie oder Augenheilkunde. Das System wurde erst in den neunziger Jahren in Europa implementiert, inzwischen wird der Diplomate-Titel teilweise schon explizit gefordert, wenn Professuren ausgeschrieben werden. Er gilt als elitärer, aber auch theoretischer als der deutsche „Fachtierarzt“, den es schon vorher gab.
Die Weiterbildung zum Diplomate beginnt mit einem gering bezahlten ein- bis zweijährigen Internship an Einrichtungen, die hochspezialisierte Tiermedizin anbieten, etwa Universitätstierkliniken und große private Kliniken. Dem Internship folgt eine mehrjährige „Residency“, sie muss zwingend unter der Anleitung eines anderen, fertig examinierten „Diplomate“ erfolgen, also an einer Klinik, in der ein solcher Tierarzt arbeitet. Um sich schließlich zur Diplomate-Prüfung anmelden zu können, an der gleichzeitig Tierärzte aus ganz Europa teilnehmen, müssen OP-Kataloge abgearbeitet sein und eigene wissenschaftliche Publikationen in hochrangigen Journals vorgelegt werden. Die zentral abgehaltene Abschlussprüfung gilt als äußerst schwer, bei den Tierchirurgen beispielsweise fallen von denjenigen, die zum ersten Mal antreten, fünfzig Prozent durch. Die Prüfung ist rein theoretisch, detailliert abgeprüft wird der Inhalt großer Standardwerke und alle Artikel der wichtigsten Fachjournale des jeweiligen Forschungsfeldes aus einem Zeitraum von zehn Jahren.
Dass diese begehrte Weiterbildung an jahrelange unbezahlte Vollzeitarbeit geknüpft wird, hat den deutschen Universitätstierkliniken - und einigen großen Privatkliniken - über Jahre den Zugang zu billigen Arbeitskräften gesichert. Aber die Universitäten haben sich selbst auch etwas genommen: die Möglichkeit, die besten Absolventen für sich und damit für die Forschung zu gewinnen. Indizien für diese Hypothese liefern zumindest die Biographien von exzellenten Studenten. Alle deutschen tiermedizinischen Ausbildungsstätten außer München honorieren jedes Jahr die beste Examensnote mit einem Preis, Leipzig hat dabei die längste Tradition. Im Jahrzehnt 1996 bis 2005 erhielten in Leipzig sieben Frauen und zwei Männer diesen Preis; in einem Jahr wurde er nicht vergeben. Ruft man alle neun an, dann stellt sich schnell heraus, dass nur eine einzige Tierärztin unter den neun die universitäre Forschungslaufbahn einschlug. Insgesamt sieben der neun „Jahrgangsbesten“ arbeiten in eigenen Praxen oder angestellt als praktische Tierärzte in Praxen und kleinen privaten Kliniken, eine Jahrgangsbeste arbeitet und forscht an einer Universitätstierklinik, eine weitere arbeitet an einem nicht-klinischen Institut einer Universität, ohne dort eine Forschungslaufbahn zu verfolgen.
Fragt man die neun ausgezeichneten Studenten, ob der gute Abschluss etwas für sie bedeutet hätte, dann unterscheiden sich ihre Antworten kaum: Die weit überwiegende Mehrheit sagt, niemand habe nach dem Examen Interesse für ihre Auszeichnung gezeigt, und man habe auch nicht versucht, sie deshalb an der Universität zu halten. Die Absolventen, die nicht an der Universität geblieben sind, findet man heute ausnahmslos in Praxen in ländlichen Gegenden. Sie hadern kaum damit, der Uni den Rücken gekehrt zu haben, und am Telefon wird ihr Ton nur ganz selten ein bisschen spitz - wenn sie etwa schildern, wie man sie nach ersten Schritten, nach ihrer Promotion, einfach ziehen ließ. Und manchmal klingen einige auch etwas wehmütig.
„Die Uni war nicht so das, was ich nach dem Examen machen wollte“, sagt eine Frau beispielsweise, die heute eine eigene Kleintierpraxis führt. „Es wär vielleicht was anderes gewesen, wenn jemand auf mich zugekommen wäre. Ich habe schon oft überlegt: Wenn du an der Uni geblieben wärst, wer weiß, was aus dir geworden wäre?“ Vielleicht, fügt sie dann vorsichtig hinzu, trage auch sie selbst die Verantwortung, weil sie so lange an ihren ursprünglichen Träumen festgehalten hätte: „Prinzipiell war für mich schon zu Beginn des Studiums immer klar, dass ich eine Praxis haben möchte und selbständig sein möchte. Ich wollte der Praktiker sein, klassisch wie im Fernsehen. Man lebt dann seinen Jugendtraum. Und man kommt erst spät darauf, dass es doch noch etwas anderes gegeben hätte.“
Allerdings hatte die Frau zunächst noch einen anderen Abzweig genommen. „Wenn man so erfolgreich gewesen ist im Studium, ist es naheliegend, erst mal eine Doktorarbeit zu machen.“ Sie wählte ein nicht-klinisches Fach an der veterinärmedizinischen Fakultät, forschte im Labor - ohne Gehalt. „Irgendwann hatte ich dann finanziell ein echtes Problem, denn die Graduiertenförderung lief nicht an.“ Sie brach die Dissertation ab, zog für eine Stelle in einer Tierarztpraxis mehrere hundert Kilometer weit weg. Dort gelang ihr dann doch noch die Promotion - extern an einem Institut der nahegelegenen humanmedizinischen Fakultät. Viel später traf sie ihren ersten Doktorvater wieder, der offenbar nichts davon gewusst hatte, dass er die Beste des Jahrgangs für sich gewonnen - und dann wieder verloren hatte. „Er sagte: Ich hab jetzt erst erfahren, was für eine Koryphäe uns entgangen ist“, erinnert sich die Frau.
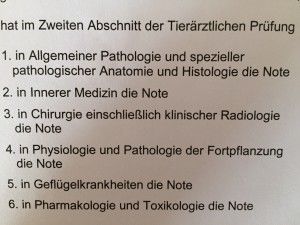
Mehrere der Jahrgangsbesten berichten wie er, dass sie mit dem Gedanken gespielt haben, eine Diplomate-Laufbahn oder zumindest einige dahin führende Bausteine wie das „Internship“ in Angriff zu nehmen, dass sie diese Idee aber schnell wieder verwarfen. „Aufgrund der schlechten Bezahlung, der befristeten Arbeitsverträge und des starken Konkurrenzdenkens“ sei sie dann doch davon abgekommen, sich nach der Promotion an einer Universitätskleintierklinik zu bewerben, sagt eine Frau etwa. Eine andere stellt klar, dass sie gern durch ein Internship in kurzer Zeit viel gelernt hätte. Aber: „Ich habe direkt nach meinem Examen gewusst, dass ich eines Tages eine Familie gründen will, und ich habe auch daran denken müssen, dass ich einmal eine Rente bekomme.“ Heute, angestellt in einer Kleintierpraxis, erlebt sie viele Kolleginnen, die acht bis zehn Jahre an der Universität verbracht haben, sie dann verlassen und mit Mitte dreißig mit der Familienplanung beginnen, so dass sie auch dann nicht wirklich in ein Berufsleben mit Verdienst einsteigen. Das, sagt die Frau, hätte sie sich für sich nicht vorstellen können.
Zwei Tierärztinnen arbeiten heute an der Universität. Eine von beiden ist Mitarbeiterin an einer Veterinärmedizinischen Fakultät in einem Dienstleistungsprojekt, für das ihr Doktorvater sie nach ihrer Promotion ans Institut zurückholte. Das Projekt lief finanziell irgendwann so gut, dass ihre Stelle entfristet wurde. Mit Forschungstätigkeiten, erklärt sie, habe ihre Stelle aber wenig zu tun, sie habe ihre Arbeitszeit immer in das Serviceprojekt gesteckt. „Ich habe drei Kinder. Ich sag immer: Meine Habil, das sind die Kinder“, sagt sie. „Man muss sich irgendwann entscheiden, und ich habe mich eben dafür entschieden.“
Die einzige Jahrgangsbeste, die heute in der universitären Forschung tätig ist, in einem klinischen Fach, absolvierte das Internship und die Residency in Kanada und den Vereinigten Staaten und legte dort auch die Diplomateprüfung ab. Ihr amerikanischer Diplomatetitel wurde dann nach ihrer Rückkehr auch als europäischer anerkannt. 18.000 kanadische Dollar erhielt sie im Internship, während der Residency dann noch etwas mehr, so dass sie sich einigermaßen über Wasser halten konnte.
Für ihre Auszeichnung als Jahrgangsbeste habe sich nach ihrem Examen zunächst niemand wirklich interessiert, erinnert sie sich wie die anderen; man habe auch nicht versucht, sie für die Universität zu gewinnen. Sie promovierte dennoch, kehrte danach aber Deutschland den Rücken und wanderte für die Diplomate-Weiterbildung aus. In Nordamerika erlebte sie dann plötzlich, wie ihre exzellente Studienleistung doch noch wichtig wurde. „In den Vereinigten Staaten ist es ein Riesenplus, Jahrgangsbester im Studium geworden zu sein“, sagt sie. „In Deutschland ist das: Glück gehabt, Streber oder so was. In Amerika ist der Jahrgangsbeste der sogenannte ‚Valedictorian‘, ein Titel, der sehr ernst genommen wird.“ Die Tierärztin nimmt heute an, dass ihr Preis ihr auch wichtige Türen öffnete, so dass sie ihre Laufbahn in Nordamerika beginnen konnte.
Nach der Diplomateprüfung kehrte sie zurück nach Deutschland, erhielt eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universitätstierklinik, wo sie derzeit habilitiert. Die aktuelle Doktoranden-Debatte an den deutschen Universitätstierkliniken hat sie verfolgt. „In dem Alter, in dem man nach dem Examen ist, sind alle hochmotiviert“, sagt sie. „Wir konnten damals Nächte und Wochenenden durchmachen. Das kann man ziemlich bösartig ausnutzen.“ Auch sie selbst habe im Internship in Kanada nur für die Klinik gelebt, dort sogar geschlafen.
Heute spricht sie oft mit den Studenten, die sie unterrichtet, darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Sie sagt, dass sie versuche, ihnen ein realistisches Bild von einer klinischen Universitätslaufbahn in der Veterinärmedizin zu vermitteln, damit sie frühzeitig wissen, wofür sie sich entscheiden, und dass sie möglicherweise auf vieles werden verzichten müssen: auf Sicherheit etwa und Familie. Sie selbst hat auch Phasen erlebt, in denen sie sich gefragt hat, was gewesen wäre, wenn sie etwas anderes studiert hätte, Humanmedizin vor allem. „Die Forschung, die ich heute betreibe, hätte ich ja auch für den Menschen machen können“, sagt sie. Trotzdem stellt sie für sich selbst fest: „Ich würde das alles noch mal genau so machen.“
Nicht alle Tierärzte, die das System durchlaufen und dabei Höhen und Tiefen erleben, blicken zurück, ohne ihre Wahl zu bereuen. Vielleicht sprechen sich ihre Zweifel inzwischen herum, auch durch vermehrte Berichte in den Medien, beispielsweise Artikel über die auch in privaten Praxen geringen Gehälter oder das anonyme Protokoll, mit dem eine Pferdetierärztin unlängst Einblick in ihren Arbeitsalltag an der Universität gewährte. Seit dem Wintersemester 2008/09 verzeichnet hochschulstart.de, die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, jedenfalls einen Abwärtstrend bei den Bewerberzahlen für das Tiermedizinstudium. Von knapp 5600 auf 4600 schrumpfte die Gesamtbewerberzahl pro Jahr für das Fach.

Ein sonniger Dienstag in einer großen deutschen Universitätsstadt. Johanna, die darum gebeten hat, in diesem Text nicht unter ihrem richtigen Namen vorzukommen, hat sich zwei Stunden frei genommen vom Lernen in der Unibibliothek. Sie sitzt in einem Studentencafé und erzählt von den Nebenjobs als Messehostess, mit denen sie sich ihr zweites Studium finanziert: Humanmedizin. In vier Wochen beginnen für sie die Physikumsprüfungen. Johanna hat sich vor anderthalb Jahren entschieden, noch einmal von vorne anzufangen. Sie bekam einen der wenigen Zweitstudienplätze für Humanmedizin, kann durch ihr zuvor abgeschlossenen Tiermedizinstudium immerhin zwei Semester einsparen. Bis sie Ärztin ist, dauert es nun insgesamt fünf statt sechs Jahre.
Von ihrem Nebenjob erzählt die 29-Jährige, weil er in dem Entscheidungsprozess für einen Neuanfang eine wichtige Rolle gespielt hat. Etliche Male hat sie Angebote großer Tierkliniken, an denen sie sich für ein extrem geringes Gehalt hätte weiterbilden können, ablehnen müssen - während ehemalige Kommilitoninnen zusagten, weil sie von ihren Eltern auch nach Examen und Promotion noch weiterfinanziert wurden. „Ich musste oft sagen: Es tut mir leid, ich kann das nicht finanzieren, als Messehostess verdiene ich mehr.“ Durch die Arbeit auf Messen hatte sie sich schon die Doktorarbeit finanziert. „Es ist schade, dass ich meinen Lebensunterhalt mit meinem Aussehen verdienen kann, aber nicht mit meinem Abschluss als Tierärztin“, sagt sie mit einem schiefen Lächeln.

Was Johanna anspricht, ist in der Tierärzteszene ein zunehmend diskutierter Missstand. Arbeitsbedingungen wie die, die durch den anonymen Brief der Münchner Doktoranden öffentlich wurden, haben Folgen, die über die unmittelbaren Konsequenzen für den einzelnen betroffenen Arbeitnehmer hinausreichen. Wenn praktische Fertigkeiten - selbst Basics wie Kastrationen oder Nähte - nur erworben werden können, indem man sich mehrere Jahre zu unbezahlter Arbeit verpflichtet, werden sie so kostbar, dass sie nicht mehr ohne weiteres weitervermittelt werden.
Eines Abends vor zwei Jahren durfte Johanna bei einer Operation in der Tierklinik wieder einmal nur das Licht richten, statt Hand anlegen zu können. Zu Hause begann sie, im Internet nach „Zweitstudium Humanmedizin“ zu suchen. „Gerade noch eine Woche lang konnte man die Bewerbung abschicken.“ Sie tat es, erhielt Wochen später eine Zusage - und nahm den Platz an. „Gleich die erste Woche hat mich schon so geflasht“, erinnert sie sich. „Bei den Einführungsveranstaltungen für das Humanmedizinstudium sagte man uns: `Sie können sich freuen, Sie haben den schönsten Studiengang gewählt, den man haben kann. Sie haben ihn zu einer tollen Zeit gewählt, Ärzte werden gebraucht, und es ist alles im Umbruch, Sie werden nicht mehr so viele Stunden arbeiten müssen, und die Biochemie entwickelt sich stark weiter, man wird immer mehr Krankheiten früh erkennen können.‘ Das bekam man gleich in der ersten Woche zu hören.“
Und sie machte bald noch mehr positive Erfahrungen: „Wir hatten im ersten SemesterHumanmedizin diese Veranstaltung: Berufsfelderkundung“, sagt Johanna. „Dort wurde uns gesagt: Wenn Sie an den Unis forschen, bekommen Sie Off-Zeiten vom Klinikdienst, weil wir erkannt haben, dass die Wissenschaft, die zwischen 20 Uhr und 6 Uhr entsteht, ohnehin keine gute Qualität hat.“ Als sie gerade drei Jahre zuvor in der Veterinärmedizin promovierte, nahm ihre Betreuerin sie gleich zu Anfang zur Seite und sagte: „Johanna, Papers schreibt man nachts, am Wochenende und im Urlaub.“

Auch deshalb wird sie nun Ärztin, hat abgeschlossen mit ihren Träumen von einer wissenschaftlichen Laufbahn als Veterinärmedizinerin. Auch wenn es manchmal schwer ist, noch mal von vorn anzufangen, während des harten Pflegepraktikums zum Beispiel, das für angehende Ärzte Pflicht ist, oder wenn sie Nebenjobs und Studium vereinbaren muss, weil man im Zweitstudium kein Bafög mehr bekommt und auch sonst kaum Anrecht auf Unterstützung hat. „Ich hab mir vorgenommen, ich mache das jetzt bis zum Physikum und schaue dann mal“, sagt sie. Die große Prüfung nach regulär zwei Jahren im Humanmedizinstudium gilt als erste schwere Hürde. Die Prüfungsfächer, auf die sich Johanna gerade vorbereitet, sind Anatomie, Physiologie, Histologie, Psychologie, Biochemie, Physik.
Anderthalb Monate nach dem Gespräch im Studentencafé kommt eine E-Mail: Johanna hat das humanmedizinische Physikum bestanden. Sie macht weiter, vier Jahre geht das Studium noch, dann ist sie 33 und Ärztin. Ein halbes Jahr rechnet sie noch zusätzlich ein - für die humanmedizinische Dissertation. Denn die will sie auf jeden Fall auch noch machen. „Wenn schon, denn schon“, sagt Johanna. „Jetzt weiß ich ja, wie das geht.“ Sie ist entschlossen, sich die Chance offenzuhalten, die ihr das erste Studium nicht ermöglichen konnte: die Chance auf eine wissenschaftliche Laufbahn und zugleich darauf, den eigenen Lebensunterhalt verdienen zu können.






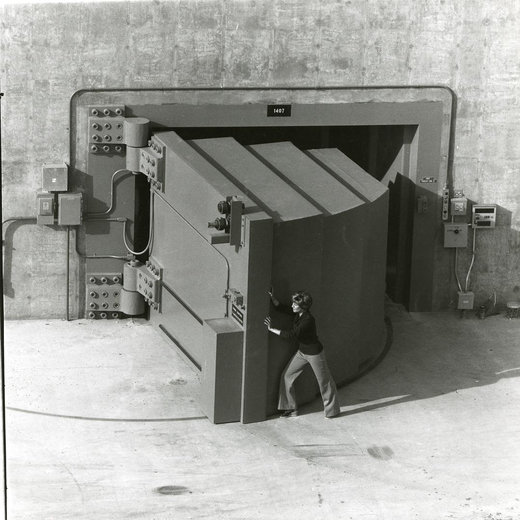
Kommentare von Lesern
für unseren Newsletter an