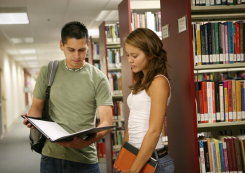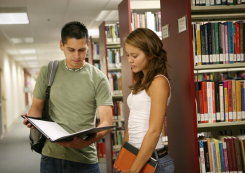
© ShutterstockDie Interessen von Studentinnen sind anders gelagert, als die ihrer männlichen Kollegen.
Neue Studie der Universität Luxemburg
Was macht naturwissenschaftliche Themen für Mädchen interessant?Forscher an der Universität Luxemburg haben herausgefunden, dass sich Mädchen weniger als Jungen für Naturwissenschaften interessieren, da diese vorwiegend anhand ,männlicher" Beispiele vermittelt werden. Wenn Physik, Informatik oder Statistik mit Themen wie ,Einkaufen im Internet" oder ,Schönheitschirurgie" erklärt wurden, stieg das Interesse der Mädchen.
Das der Jungen hingegen nahm bei diesen Themen ab. ,Naturwissenschaftliche Themen, die in einer Art vermittelt werden, die als stereotypisch weiblich gilt, erlauben den Mädchen, ihr Selbstverständnis als heranwachsende Frau zu bewahren," erklären die Forscher in ihrer Veröffentlichung im "British Journal of Educational Psychology".