OF THE
TIMES


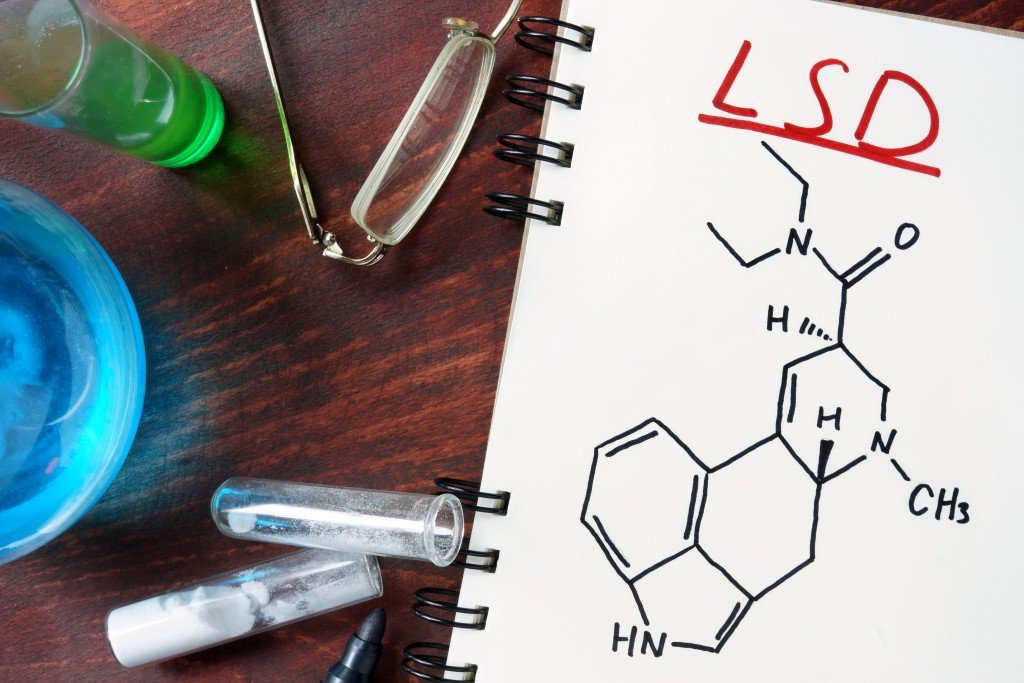
"Freundschaft unter Frauen liegt nur einen Katzensprung entfernt von unserer Schwesternschaft, und Schwesternschaft kann einem sehr viel Kraft verleihen" - Jane FondaIn alten Zeiten teilten Frauen viel mehr miteinander als sie es heutzutage tun. Sie teilten sich in die Fürsorge für ihre Babys, sammelten Nahrung und bereiteten diese gemeinsam zu. Die Frauen und die Kinder teilten ein Leben in enger Verbundenheit und sie waren eine tägliche Quelle der Kraft und des Trostes füreinander. Traditionen wie das Rote Zelt, wo Frauen während ihrer Menstruation zusammen kamen, oftmals mit synchronisierten Zyklen, waren eine wunderschöne Zeit des Nährens und des Teilens von Frauenangelegenheiten, und sie diente dazu, sich gegenseitig resilient und glücklich zu erhalten.
Kommentar: Ohne Kritikfähigkeit kein inneres Wachstum: Wie du lernen kannst, Kritik gesund anzunehmen