Wer ohnehin schon gut ist, dem schmeichelt Lob vielleicht. Anspornen tut es aber vor allem jene, die bei der Verteilung der Lorbeeren erst einmal leer ausgehen.

© Southern Illinoisan
Egal ob Eltern die besonderen Leistungen ihrer Kinder hervorheben oder Arbeitgeber den Einsatz ihrer Angestellten würdigen - Lob soll Menschen in den meisten Fällen nicht nur ein gutes Gefühl vermitteln, sondern sie auch dazu motivieren, sich weiterhin ins Zeug zu legen. Ein Team um Nick Zubanov von der Universität Konstanz konnte nun zeigen, dass diese Rechnung tatsächlich aufgeht - allerdings anders, als man vielleicht erwarten würde: An Stelle der Gelobten selbst profitierten in einem Experiment nämlich eher jene Personen von der Würdigung,
deren Leistungen gar nicht hervorgehoben worden waren.
Zubanov untersuchte mehr als 300 niederländische Studierende, die an verschiedenen Tutorien zur Mikroökonomie teilnahmen. Nach einer ersten Klausur zur Mitte des Semesters lobten die Verantwortlichen in manchen der Lerngruppen jene 30 Prozent der Teilnehmer, die die besten Noten erzielt hatten, vor versammelter Mannschaft. In den anderen Tutorien wurde kein öffentliches Lob ausgesprochen. Um herauszufinden, welchen Einfluss das auf den weiteren Studienerfolg der Probanden hatte, schaute sich Zubanov wenig später die Noten einer zweiten Klausur an, welche die Teilnehmer am Ende des Semesters absolvieren mussten. Dabei entdeckten die Forscher, dass sich die ohnehin schon guten Studenten, die zuvor das Lob erhalten hatten, kaum verbesserten.
Stattdessen schienen aber jene Teilnehmer zu profitieren, die besonders fleißig waren und sich mit ihren Noten in der ersten Klausur knapp unterhalb der besten 30 Prozent bewegt hatten: Sie legten angesichts der öffentlichen Huldigung anderer im Vergleich zur Kontrollgruppe eine deutliche Leistungssteigerung hin. Das hängt in den Augen Zubanovs damit zusammen, dass durch die verbale Anerkennung deutlich kommuniziert wird, wo die Messlatte für diese Aufgabe hängt. "Die Leistung der Studierenden wird nicht nur durch den persönlichen Nutzen beeinflusst, wie das Bestehen einer Prüfung, sondern auch durch die für diese Leistung vermutete Norm gesteuert", so der Forscher. Während die guten Studenten erfahren, dass sie die Norm bereits erfüllen,
werden die übrigen Teilnehmer so dazu motiviert, sich noch mehr anzustrengen, um zu den Spitzenreitern aufzuschließen.



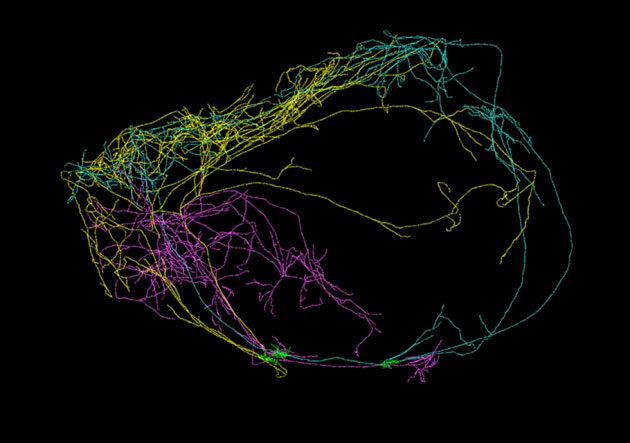








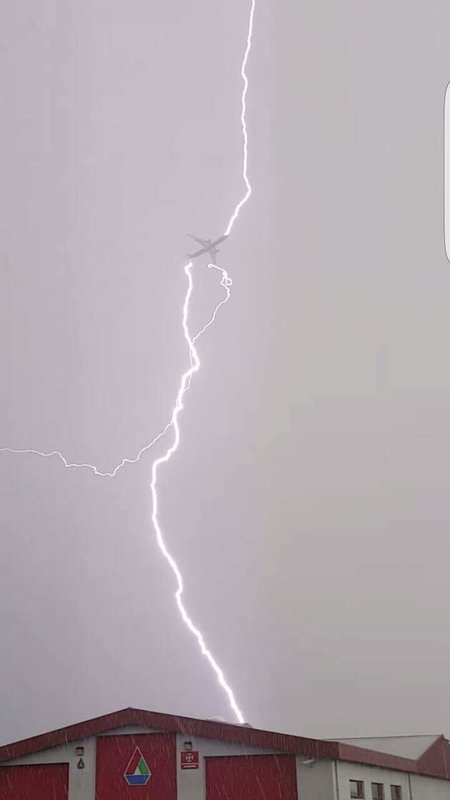
Kommentar: