Die kraftvollsten Geschichten dürften jene sein, die wir uns selbst erzählen, sagt Brené Brown. Doch Vorsicht - sie sind für gewöhnlich Fiktion.
Mein Mann Steve und ich hatten einen dieser Tage. An jenem Morgen haben wir verschlafen. Charlie konnte seinen Rucksack nicht finden und Ellen musste sich aus dem Bett quälen, da sie lange wach geblieben war, um zu lernen. Auf Arbeit hatte ich dann fünf Besprechungen direkt hintereinander und Steve, ein Kinderarzt, hatte mit der Erkältungs- und Grippesaison zu kämpfen. Um die Zeit des Abendessens waren wir praktisch den Tränen nahe.
Steve öffnete den Kühlschrank und seufzte. "Wir haben keine Lebensmittel. Nicht einmal Aufschnitt." Ich fauchte zurück: "Ich tue mein Bestes. Du kannst auch einkaufen gehen!" "Ich weiß", erwiderte er mit gemäßigter Stimme. "Ich tue es jede Woche. Was ist los?"
Ich wusste genau, was los war: Ich hatte seinen Kommentar zu einer Geschichte umgewandelt: dass ich eine unorganisierte, unzuverlässige Partnerin und Mutter sei. Ich entschuldigte mich und begann meinen nächsten Satz mit der Phrase, die zur großen Hilfe in meiner Ehe, der Kindererziehung und im Berufsleben geworden war:
"Die Geschichte, die ich erfinde ist die, dass du mir die Schuld dafür gibst, dass keine Lebensmittel da sind - dass ich es vermasselt habe."
Steve sagte: "Nein, ich wollte gestern einkaufen gehen, aber ich hatte keine Zeit. Ich gebe dir keine Schuld. Ich bin hungrig."
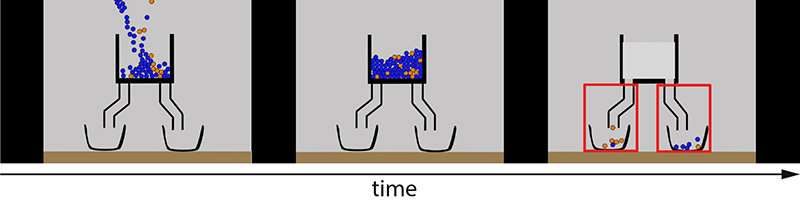

Kommentar: