
Können sich schwere Traumata in der Kindheit- wie sexueller Missbrauch oder Gewalt auch auf die folgenden Generationen übertragen? Die Theorie der transgenerativen Übertragung besteht schon seit längerem. Ein Team der Charité in Berlin will dieser Frage nun nachgehen.
Übertragen sich Kindheitstraumata, wie beispielsweise frühe Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, auf folgende Generationen? Lassen sich die Spätfolgen von Kindheitstraumata in darauffolgenden Schwangerschaften nachweisen? Und haben Kinder von Müttern, die solche Erfahrungen gemacht haben, aufgrund dieser veränderten pränatalen Bedingungen ein erhöhtes Krankheitsrisiko? Diesen Fragen gehen Forscher um Prof. Dr. Claudia Buß an der Charité - Universitätsmedizin Berlin in den kommenden fünf Jahren nach. Mit 1,48 Millionen Euro fördert der Europäische Forschungsrat die geplanten Untersuchungen. Die Arbeiten beginnen in diesem Monat und erste Frauen werden in die Studien aufgenommen.
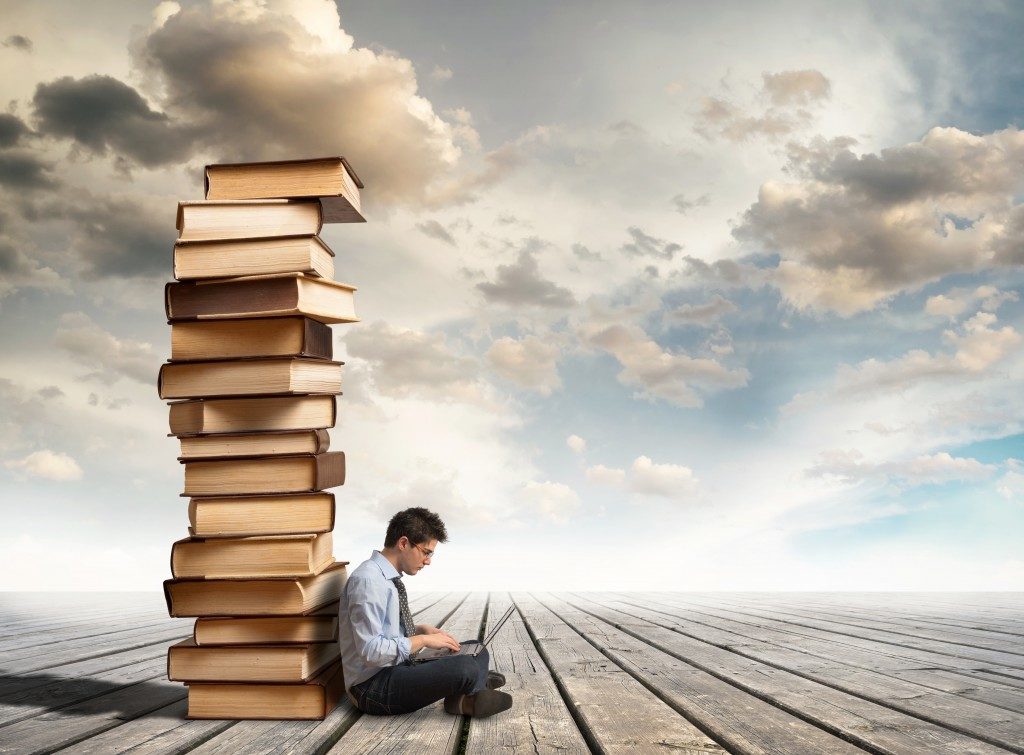



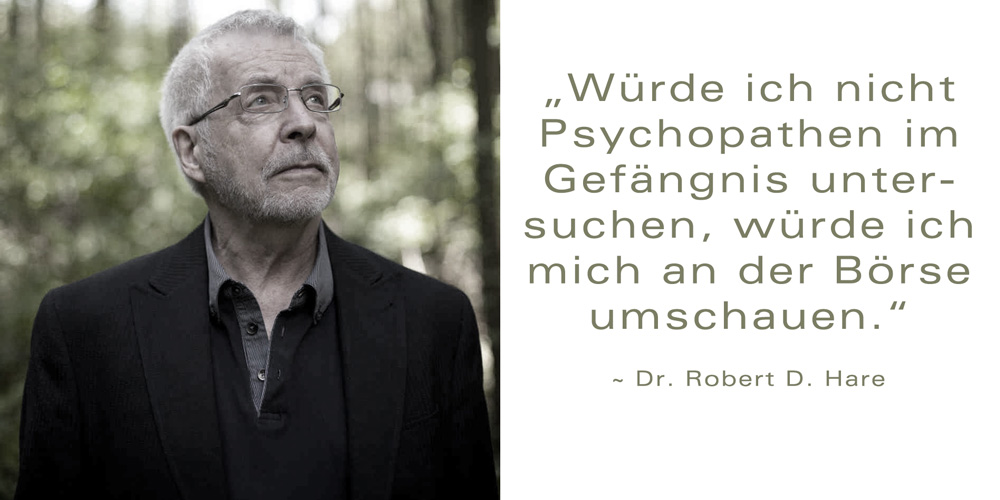
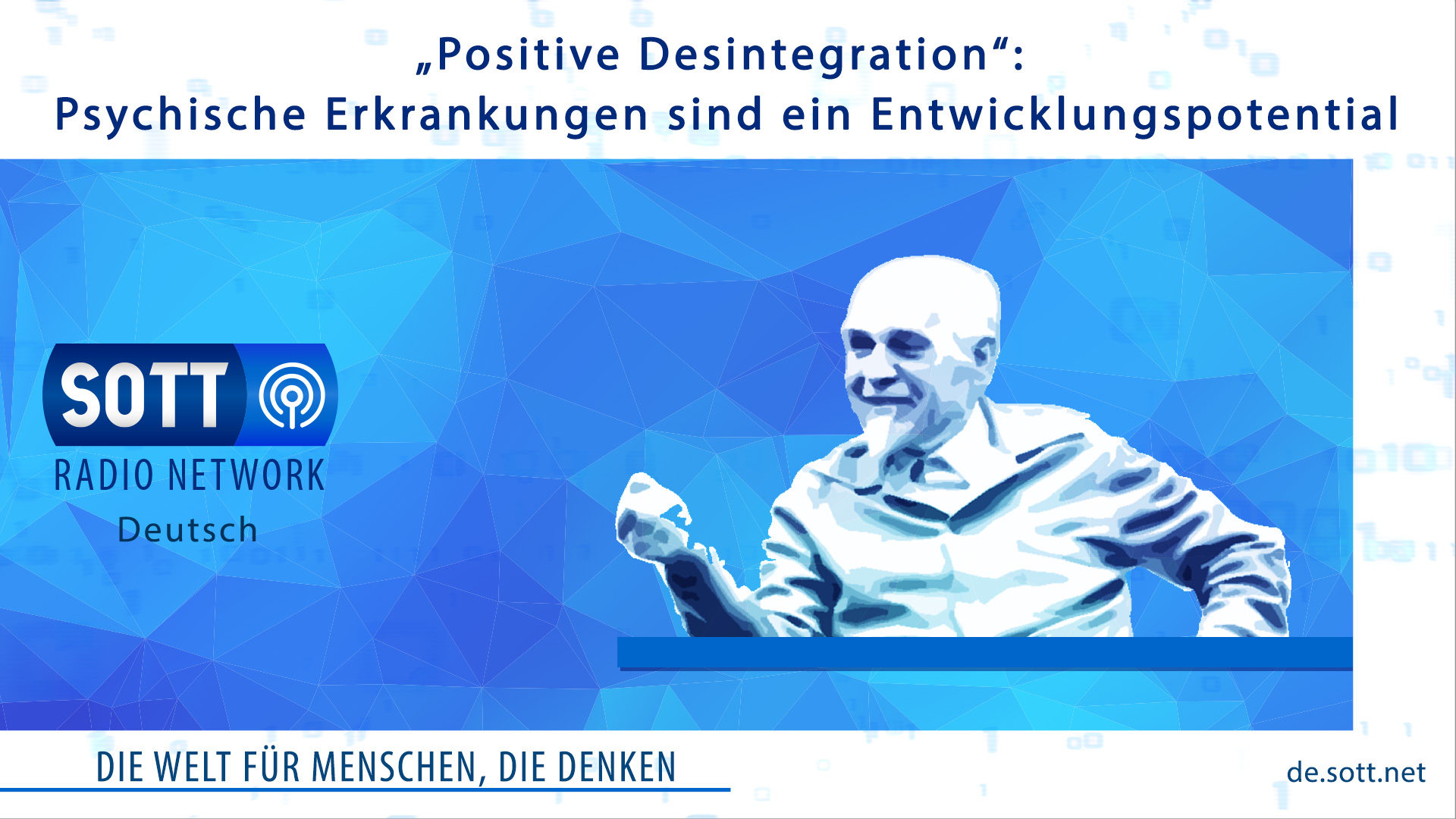





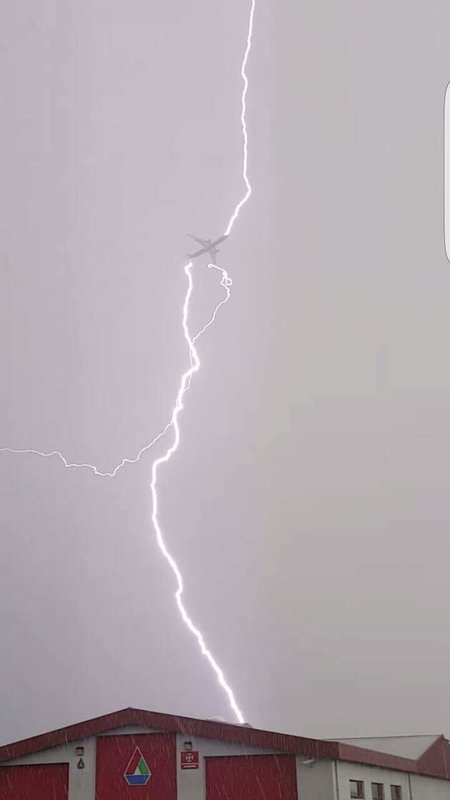
Kommentar: